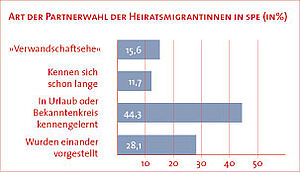Im Lauf unserer Studie über erfolgreiche Arbeit mit Migrantenfamilien in diversen Projekten in Neukölln stießen wir in erster Linie auf Nutzerinnen, denen eines gemeinsam ist: Sie haben ihre Kindheit und Jugend in einem anderen Land verbracht und sind erst vor Kurzem aufgrund einer Heirat nach Deutschland gekommen. Allem Anschein nach sind es also nicht so sehr Migrantinnen der zweiten oder dritten Generation, die die untersuchten Angebote nutzen, vielmehr scheinen Heiratsmigrantinnen diese Unterstützung besonders hilfreich zu finden.
Das fanden wir so bemerkenswert, dass wir in einem Exkurs darüber reflektieren wollen, womit diese Projekte den Bedürfnissen der Heiratsmigrantinnen entgegen kommen. Das scheint uns nicht zuletzt deshalb interessant, weil Heiratsmigration oft als Integrationshindernis gilt, da man negative Auswirkungen auf die Sozialisationsbedingungen der Kinder fürchtet, wenn ein Elternteil im Ausland aufgewachsen ist und von dort in aller Regel keine oder nur geringe Deutschkenntnisse mitbringt. Gleichzeitig ist bekannt, dass viele Migranten und Migrantinnen der zweiten und dritten Generation Partner heiraten, die im Ausland aufgewachsen sind. Auch wenn es keine genauen Zahlen gibt, lässt sich doch vermuten, dass in vielen Stadtteilen ein Drittel oder sogar die Hälfte der Kinder mit Migrationshintergrund in einer Familie aufwächst, bei der ein Elternteil erst nach der Heirat nach Deutschland kam (vgl. STRAßBURGER 2000). Es handelt sich also keineswegs um eine Ausnahme, und so scheint es uns angebracht, diesem Thema weiter nachzugehen.
Dazu arbeiten wir zunächst einmal typische Merkmale der Lebenssituation von Heiratsmigrantinnen heraus. Anschließend fragen wir, in welcher Hinsicht sie auf Unterstützung angewiesen sind, wo sie diese bekommen und / oder wo sie ihnen fehlt. An diese Überlegungen schließt sich eine Betrachtung verschiedener Projekte an, bei denen uns aufgefallen ist, dass sie besonders stark von Heiratsmigrantinnen besucht werden oder sogar wesentlich auf der aktiven Mitarbeit dieser Personengruppe basieren. Wir gehen der Frage nach, inwiefern die Arbeitsansätze dieser Projekte besonders gut auf die Lebenssituation dieser Personengruppe reagieren. Auf diese Weise wollen wir Faktoren herausarbeiten, die sich bei der Arbeit mit Heiratsmigrantinnen als hilfreich erweisen.
Was kennzeichnet die Lebenssituation von Heiratsmigrantinnen?
Wie geht es Heiratsmigrantinnen in Deutschland? Was hat sie bewogen,einen Mann zu heiraten, der hier lebt, und ihre Heimat zu verlassen? Wie zufrieden sind sie mit ihrer Entscheidung? Wie finden sie sich hier zurecht? Wie erziehen sie ihre Kinder?
Ein Blick in die Fachliteratur macht eines mehr als deutlich: Es mangelt bislang an fundierten Studien zu all diesen Fragen. Nur wenige Untersuchungen gehen auf das Phänomen der Heiratsmigration oder auf die Situation der Heiratsmigrantinnen ein und liefern Informationen zu den oben genannten Fragen. Wir werden versuchen, einige der vorliegenden Ergebnisse zusammenzufügen. Außerdem schildern wir, wie sich die Situation von Heiratsmigrantinnen darstellt, die wir im Lauf unserer Studie kennengelernt haben.
Dem spärlichen Kenntnisstand aus wissenschaftlicher Sicht steht eine Fülle von Klischees gegenüber, die nahezu unhinterfragt verbreitet werden. Sie betreffen vor allem Heiratsmigrantinnen aus muslimisch geprägten Gesellschaften. Nachdem das Thema lange Zeit nur in Fachkreisen diskutiert worden war, hat es mittlerweile ziemlich große Popularität erlangt. Nicht zuletzt wegen des Buches von Necla Kelek »Die fremde Braut« (2005).
Bei der Lektüre dieses Bestsellers gilt es zu beachten, dass sein Fokus – trotz des Titels – keineswegs auf Heiratsmigrantinnen gerichtet ist, sondern auf diverse Gewaltphänomene, die Kelek in der türkischen Bevölkerung beobachtet und kritisiert; insbesondere auf Zwangsehen. In diesem Kontext greift sie auch das Thema Heiratsmigration auf, da sie – berechtigterweise – davon ausgeht, dass sich Heiratsmigrantinnen wegen ihrer rechtlich und sozial relativ prekären Lebenslage besonders schlecht wehren können, falls sie von einer Zwangsverheiratung betroffen sind.
Nun sollte man aber nicht im Umkehrschluss alle Heiratsmigrantinnen als Opfer von Zwangsehen betrachten. Schon der Begriff »Importbräute«, den Kelek verwendet, könnte dazu verleiten, anzunehmen, bei Heiratsmigrantinnen würde es sich nicht um selbstbestimmt handelnde Personen handeln, sondern um hilflose Opfer patriarchaler Verhältnisse. Die Schilderung der Lebenssituation von Heiratsmigrantinnen, die Kelek präsentiert, enthält leider obendrein eine Fülle von Verallgemeinerungen, die wenig zum Verständnis beitragen.
»Die typische Importbraut ist meist gerade eben 18 Jahre alt, stammt aus einem Dorf und hat in vier oder sechs Jahren notdürftig lesen und schreiben gelernt. Sie wird von ihren Eltern mit einem ihr unbekannten, vielleicht verwandten Mann türkischer Herkunft aus Deutschland verheiratet. Sie kommt nach der Hochzeit in eine deutsche Stadt, in eine türkische Familie. Sie lebt ausschließlich in der Familie, hat keinen Kontakt zu Menschen außerhalb der türkischen Gemeinde. Sie kennt weder die Stadt noch das Land, in dem sie lebt. Sie spricht kein Deutsch, kennt ihre Rechte nicht, noch weiß sie, an wen sie sich in ihrer Bedrängnis wenden könnte. In den ersten Monaten ist sie total abhängig von der ihr fremden Familie, denn sie hat keine eigenen Aufenthaltsrechte. Sie wird tun müssen, was ihr Mann und ihre Schwiegermutter von ihr verlangen. Wenn sie nicht macht, was man ihr sagt, kann sie von ihrem Ehemann in die Türkei zurückgeschickt werden – das würde ihren sozialen oder realen Tod bedeuten. Sie wird bald ein, zwei, drei Kinder bekommen. Ohne das gilt sie nichts und könnte wieder verstoßen werden. Damit ist sie auf Jahre an das Haus gebunden. Da sie nichts von der deutschen Gesellschaft weiß und auch keine Gelegenheit hat, etwas zu erfahren, wenn es ihr niemand aus ihrer Familie gestattet, wird sie ihre Kinder so erziehen, wie sie es in der Türkei gesehen hat. Sie wird mit dem Kind türkisch sprechen, es so erziehen, wie sie erzogen wurde, nach islamischer Tradition. Sie wird in Deutschland leben, aber nie angekommen sein.
Kaum jemand spricht mit diesen Frauen, weil diese in der Öffentlichkeit meist auch gar nicht auftauchen. Sie sind in den Familien, in den Häusern versteckt, sie können sich nicht mit Deutschen verständigen, sie haben keinen Kontakt zu Menschen, die ihnen helfen könnten, zu Behörden, Sozialarbeitern oder Beratungsstellen. … Am ehesten trifft man diese Frauen in den Moscheen. … Mit den Deutschen wollen sie in der Regel gar nichts zu tun haben. Sie sprechen deren Sprache nicht, sie verstehen deren Kultur nicht, und die Lebensweise der Deutschen wird gerade von den überzeugt religiösen Musliminnen verachtet.« (KELEK 2005:171 ff.)